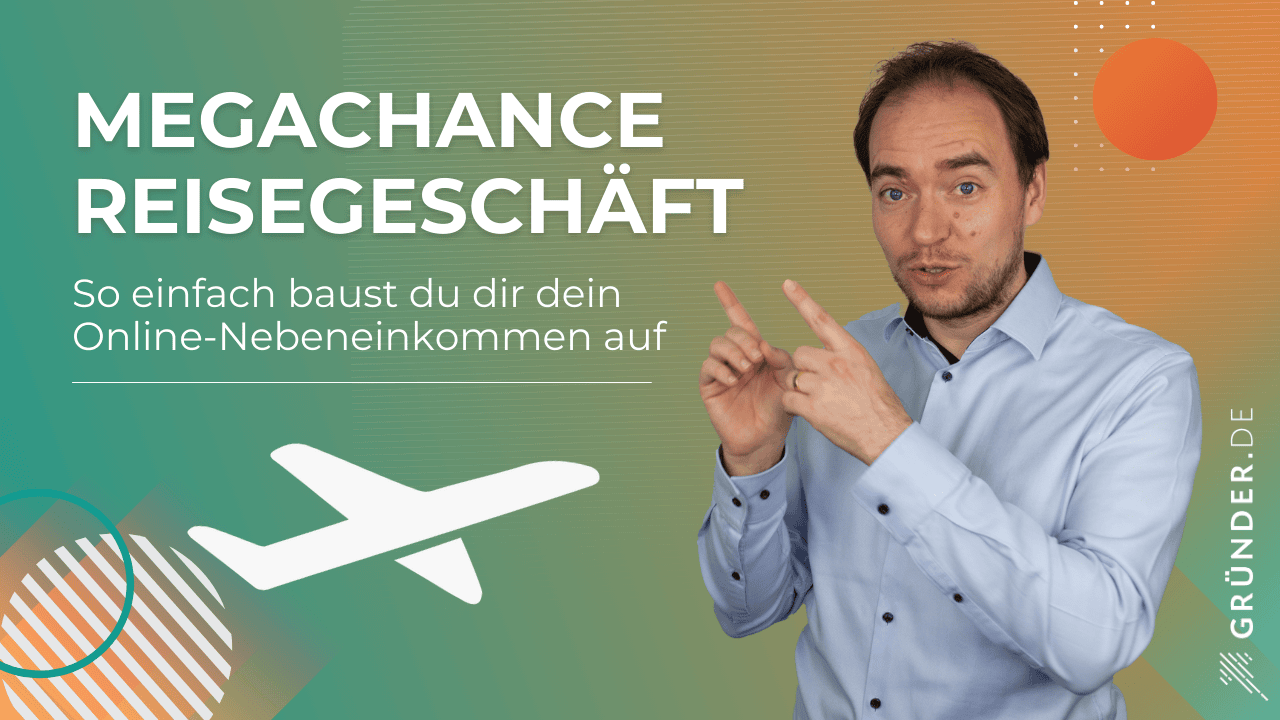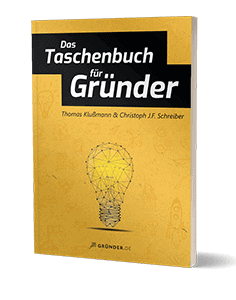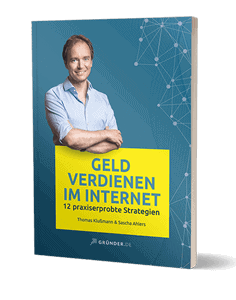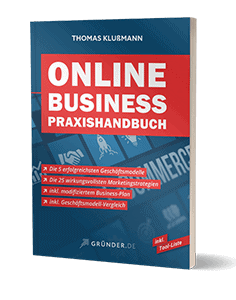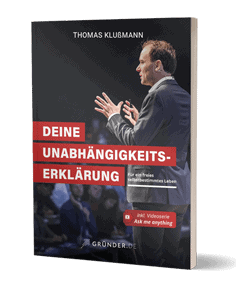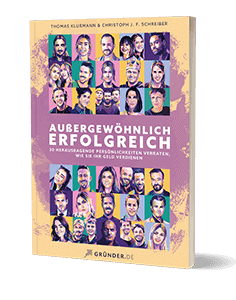Gründer FAQ: Das sind die Basics
Können KI-Chatbots als „Mitarbeiter“ Verträge schließen?
 Christian Solmecke
| 18.03.2024
Christian Solmecke
| 18.03.2024

Featured image: DIgilife - stock.adobe.com
In unserem Gründer FAQ erfährst du, ob und unter welchen Bedingungen KI-Chatbots für dich Verträge schließen können.
Inhaltsverzeichnis
- KI-Chatbots als Stellvertreter
- KI als „dynamisches Formular“
- Was beim Einsatz von KI-Chatbots zu beachten ist
- Der Datenschutz spielt auch bei KI-Chatbots eine Rolle
- KI -Wissen aufbauen und erfolgreich monetarisieren
Gesamtes Inhaltsverzeichnis anzeigen
Chatbots können längst mehr als einfach vorgegebene Dialogoptionen abzufragen. Was sich früher mit Bot-Kundenassistenten schon stellenweise nach einem Gespräch angefühlt hat, ist mit Sprachmodellen wie GPT-4 inzwischen schon kaum noch von einem echten Dialog zu unterscheiden. Möchte man sich KI-Chatbots als „Verkäufer-Ersatz“ nun zunutze machen, stellen sich einige Rechtsfragen – insbesondere die Frage danach, ob sie wirksam im Namen des Unternehmens Verträge schließen können.
KI-Chatbots als Stellvertreter
KI-Chatbots stehen echten, angestellten Verkäufern in einer Sache nach: Sie sind keine Menschen, auch wenn sich die Kommunikation mit ihnen häufig doch genau so anfühlt. Eine Stellvertretung, durch welche die KI Willenserklärungen im Namen des Unternehmens abgeben und damit wirksam Verträge schließen könnte, kommt deshalb aber nicht in Betracht. Denn der § 164 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) setzt voraus, dass der Vertreter dafür eine eigene Willenserklärung abgibt. Und das Bilden eines Willens ist aktuell nur Menschen aus Fleisch und Blut vorbehalten. Jedenfalls sieht das die Rechtsprechung seither so.
Es gibt allerdings schon zahlreiche Theorien dazu, wie das Recht hier nachziehen könnte. Manche wenden die Regeln zur Zurechnung von Willenserklärungen aus dem BGB einfach trotzdem auf KI an, andere sprechen von sogenannten „E-Personen“. Aber wie so viele Entwicklungen im Recht fängt es hier mit Ideen an, die eine ganze Weile brauchen, bis sie rechtssicher in der Realität angekommen sind.
KI als „dynamisches Formular“
Vorerst sind KI-Chatbots damit eher eine Art interaktives und hochdynamisches Formular. Wie bei einem Vorgespräch kann die KI im Dialog aber die Kundenwünsche abstecken und die Vertragsbedingungen ausarbeiten. Am Ende des Dialogs könnte sie dann auf das Shopsystem verweisen, bei dem der Kunde die Bestellung überprüfen und abschicken kann. Oder aber man klärt alles im Dialog, was allerdings die rechtlichen Anforderungen an die KI erhöht.
Vertragsrechtlich gilt dabei im Grunde nichts anderes als schon jetzt im einschlägigen Online-Versandhandel: Die KI macht das Vertragsangebot nicht, sondern arbeitet ein Angebot des Kunden aus, das dieser gegenüber dem Unternehmen abgibt. Dabei ist die automatische Bestellbestätigung übrigens nicht die Annahme des Kaufvertrages. Eine ausdrückliche Annahme bei jedem einzelnen Geschäft ist hier unpraktisch und rechtlich auch nicht notwendig: § 151 BGB macht eine Annahme des Verkäufers dann entbehrlich, wenn der Kunde sie „nach der Verkehrssitte“ nicht erwartet. Beim Online-Versand ist es üblich und anerkannt, dass eine Bestellung in der Regel auch direkt zum Kauf führt. Nur in Ausnahmefällen erwartet man deshalb eine Meldung des Verkäufers selbst. Der Vertrag kommt also grundsätzlich bereits ohne Annahme zustande – spätestens durch schlüssiges Verhalten mit der Versendung der bestellten Ware.
Die KI schließt den Vertrag also nicht per se persönlich, sondern sie verhilft dem Kunden dabei, seine Vertragserklärung abzugeben. Da es im E-Commerce regelmäßig aber keine Annahme braucht, kann sie damit praktisch den Vertrag zustande bringen. Dabei gibt es aber dennoch eine Menge zu beachten.
Was beim Einsatz von KI-Chatbots zu beachten ist
Je großflächiger der Einsatz von KI in der Vertragsanbahnung ist, umso höher sind auch die rechtlichen Anforderungen.
Wird ein KI-Chatbot zum Beispiel nur dafür eingesetzt, Kaufinteressenten zu finden, um sie auf die eigene Shopseite weiterzuleiten, gibt es zumindest im Kaufrecht keine besonderen Verbraucherschutzvorschriften, die beachtet werden müssen. Letztlich wird der Vertrag hier nicht mit dem Chatbot gestaltet.
Wenn aber nun im anderen Extremfall per Chatbot die Vertragsbedingungen schon so weit finalisiert werden sollen, dass der Kunde sie nur noch abzuschicken braucht, stellt das Recht höhere Anforderungen. Dann muss die KI genau den Regeln genügen, die schon für den „klassischen“ E-Commerce gelten: Es muss etwa garantiert werden, dass die KI stets auf die verpflichtenden Vertragsbestandteile nach Art. 246a Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) hinweist. Dazu gehören insbes. die Eigenschaften der Dienstleistung/Ware, die Identität des Unternehmers und das Bestehen des Widerrufsrechts. Für die umfänglichen Informationen müsste die KI dann eine Mail veranlassen oder auf eine Info-Website verweisen. Außerdem muss im Zweifel auch der Chatbot deutlich machen, dass es sich um einen kostenpflichtigen Kauf handelt und dem Käufer die Gelegenheit geben, die Angaben vor Vertragsschluss zu überarbeiten.
Der Datenschutz spielt auch bei KI-Chatbots eine Rolle
Zudem muss auch bei KI-Chatbots der Datenschutz beachtet werden, soweit persönliche Daten wie Namen, Adressen oder Kundennummern im Chat angegeben werden. Auch eine Datenverarbeitung durch eine Chat-KI muss eine Rechtsgrundlage nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben. Denkbar ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der eine Datenverarbeitung dann erlaubt, wenn sie zur „Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen“ erforderlich ist. Die genannten Daten sind typischerweise solche, die für den Kauf von Relevanz sind, sodass das hier durchaus passt. Dabei dürfen vor allem nicht mehr Daten als unbedingt notwendig abgefragt werden – der Unternehmer muss den Chatbot also so begrenzen, dass er nur Dateneingaben zulässt oder bewusst fordert, die der Vertragsgestaltung dienen.
Es reicht also nicht, die KI-Chatbots „einfach machen zu lassen“ – du musst sie bewusst begrenzen und inhaltlich vorformen, um bestimmte Angaben zu garantieren und vor allem auch nicht über die Stränge zu schlagen. Es gelingt momentan zumindest schon, bestimmte Inhalte aus den KI-Ergebnissen zu filtern. ChatGPT etwa lässt keine Ausgaben zu, die gemeingefährdend sind. Die wahre Herausforderung wird also nicht darin liegen, KI für den Vertragsprozess einzubinden, sondern sie so zu bändigen, dass sie rechtssicher bleiben.
Nähere Informationen und Tipps rund um das Thema erhältst du auf wbs-law.de.
KI -Wissen aufbauen und erfolgreich monetarisieren
Du interessierst dich für KI und die Business-Opportunities, die sich dahinter verbergen? Dann entdecke jetzt mit uns die Chancen in diesem noch jungen Markt. Reserviere jetzt deinen KOSTENLOSEN Platz im KI Live Event.
So kapitalisierst du das Marktpotenzial von KI:
- Lerne neue, durch KI geprägte Geschäftsfelder kennen sowie den Markt und seine Potenziale
- Erhalte Einblicke von Experten aus der Branche, die dir dabei helfen, die Potenziale und Herausforderungen von KI besser zu verstehen
- Entdecke mit uns die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich der KI, die in nahezu jedem Unternehmen relevant sind
- Bau relevantes Wissen zum Thema KI auf und lerne, wie du dieses Wissen erfolgreich monetarisierst
Positioniere dich jetzt und gehe als Gewinner aus der KI Revolution hervor!
Für Teams und entscheider

- Deine Geschäftschancen am Billionenmarkt KI
- 13. & 14.05.2024
- Live aus dem Gründer.de Studio
- 5 Top KI-Speaker
DU willst deine KI-Skills aufs nächste Level heben?
WIR machen dich bereit für die Revolution
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ!
- Praxisbeispiele – sofort anwendbar für dein Business
- Aktuelle KI-Tools im Check
- Expertentipps für die neusten KI-Technologien
- Case Studies – von E-Mail-Marketing bis Datenanalyse
Ja, ich möchte den Newsletter. Die Einwilligung kann jederzeit im Newsletter widerrufen werden. Datenschutzerklärung.
Über den Autor

Christian Solmecke
Rechtsanwalt Christian Solmecke hat in seiner Kölner Kanzlei WBS.LEGAL den Bereich Internetrecht/E-Commerce stetig ausgebaut. Er betreut dort zahlreiche Online-Händler, Medienschaffende und Web-2.0-Plattformen. Daneben ist RA Solmecke Gründer von anwalt2go sowie mehreren IT-Startups. Seine ersten Projekte hat er selbst programmiert. Neben seiner Kanzleitätigkeit und der Geschäftsführung der cloudbasierten Kanzleisoftware Legalvisio.de ist Christian Solmecke Autor zahlreicher Fachbücher zum Thema Online-Recht und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht im Internet (DIKRI) an der Cologne Business School (http://www.dikri.de). Dort beschäftigt er sich insbesondere mit den Rechtsfragen in Sozialen Netzen. Vor seiner Tätigkeit als Anwalt arbeitete Solmecke mehrere Jahre als Journalist für den Westdeutschen Rundfunk und andere Medien.