Das gibt es beim Gründen einer eG zu beachten
Eingetragene Genossenschaft: Vor- und Nachteile für Teams und Kooperationen
 Luisa Färber und Leoni Schmidt
| 28.02.2024
Luisa Färber und Leoni Schmidt
| 28.02.2024

Eine eingetragene Genossengemeinschaft, kurz eG, kann für Unternehmen viele wirtschaftliche Vorteile bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Definition: Was ist eine eingetragene Genossenschaft?
- Wie gründet man eine eG?
- Die Satzung/ der Gründungsvertrag – Was gibt es hier zu beachten?
- Haftung bei der eingetragenen Genossenschaft
- Kosten der Rechtsform
- Steuern der eG-Gesellschaft
- Für wen eignet sich diese Rechtsform?
- Fazit: Die Vor- und Nachteile einer eG
- Wie löst man eine eingetragene Genossenschaft wieder auf?
- Häufige Fragen (FAQ) zur eingetragenen Genossenschaft
Gesamtes Inhaltsverzeichnis anzeigen
Definition: Was ist eine eingetragene Genossenschaft?
Die eingetragene Genossenschaft ist eine weitere Form der Kapitalgesellschaften. Hierbei handelt es sich sowohl um eine Rechtsform für Gründungsteams als auch um ein Kooperationsmodell für mittelständische Unternehmen. Die eingetragene Genossenschaft fungiert hier als juristische Person. Die eG verfolgt das Ziel, durch einen Zusammenschluss von Genossen Wissen zu teilen, leichter Aufträge und bessere Chancen auf dem Wirtschaftsmarkt zu bekommen. Häufig findet man diese Rechtsform der eG-Gesellschaft bei Unternehmen im Handel, in der Landwirtschaft, bei Banken oder in der Gesundheitsbranche. Beim Gründen einer eingetragene Genossenschaft, musst du darauf achten, den Zusatz „eG“ im Firmennamen zu haben.
Wie gründet man eine eG?
Damit eine eingetragene Genossenschaft gegründet werden kann, müssen sich mindestens drei Gründungsmitglieder zusammenschließen. Das können beispielsweise auch drei UGs oder GmbHs sein, also schon bestehende Firmen, bei denen die Gründungsmitglieder der zukünftigen eG Geschäftsführer sind.
Danach müssen von diesem Gründungsteam zwei Konzepte erstellt werden. In dem einem Konzept soll das Wirtschaftskonzept erläutert werden, sprich: Welchen Zweck soll die Genossenschaft haben, welche Tätigkeiten solchen betrieben werden, wie viel Umsatz soll gemacht werden und welches Mitglied soll welche Ämter und Aufgaben übernehmen. Dieses ähnelt damit stark einem Businessplan. Zudem muss hier der Name der eG festgelegt werden. Bei dem zweiten Konzept handelt es sich um die Satzung, bzw. dem Gründungsvertrag. In der Satzung wird die Struktur der eingetragenen Genossenschaft festgelegt. Bei dieser ist es sinnvoll, einen Notar oder Rechtsanwalt zur Hilfe zu holen, damit er diese für die eG-Gesellschaft einmal prüfen kann.
Als nächstes folgt die Gründungsprüfung durch den genossenschaftlichen Prüfungsverband, der sich dann die beiden Konzepte anschaut. Dieser gibt dann bezüglich des Konzeptes eine Stellungnahme ab, die Voraussetzung für die Eintragung ins Genossenschaftsregister ist. Bekommt man dann ein positives Gutachten erstellt, kann man die Genossenschaft ins Genossenschaftsregister eingetragen. Dafür muss ein Eintragungsantrag erstellt werden, der in einem elektronischen Verfahren zunächst an einen Notar und dann an das zuständige Registergericht übermittelt wird.
Die Satzung/ der Gründungsvertrag – Was gibt es hier zu beachten?
Wie vorher schon erwähnt, ist für das Gründen einer eG ein Gründungsvertrag, bzw. in dem Fall eine Satzung schriftlich notwendig. In dieser sollten folgende Punkte enthalten sein:
- Firma, Sitz und Gegenstand der eingetragenen Genossenschaft müssen angegeben werden
- Es muss bestimmt werden, ob die Mitglieder der eG für den Fall, dass Insolvenzzahlungen nicht gedeckt werden können, Nachschüsse zum Geldbetrag unbeschränkt, beschränkt auf seine Summe oder gar nicht leisten müssen
- In welcher Form sollen Generalversammlungen der Mitglieder einberufen werden?
- Wie werden Beschlüsse beurkundet?
- Wer übernimmt den Vorsitz der Versammlung in der eG-Gesellschaft?
- In welcher Form sollen Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgen und in welchen öffentlichen Blättern sollen diese zu sehen sein?
Haftung bei der eingetragenen Genossenschaft
Da es sich bei der eingetragenen Genossenschaft um eine juristische Person handelt, haftet diese mit ihrem Vermögen. Für die Mitglieder bedeutet das, dass sie mit ihren Einzahlungen auf die Geschäftsanteile, die Teil des haftenden Eigenkapitals der Genossenschaft sind. Kommt es bei dem Unternehmen zu einer Insolvenz, kann es gut sein, dass die Mitglieder mit zusätzlichen Zahlungen herangezogen werden. Dies ist davon abhängig, ob nach der Satzung weitere Zahlungen zu leisten sind oder ob Zuschüsse ausgeschlossen sind. Dies wird bei der Gründung in der Satzung bzw. im Gründungsvertrag der eG-Gesellschaft festgehalten.
Kosten der Rechtsform
Da man sich bei der Gründung einer eingetragenen Genossenschaft an bestimmte Rechtsformen halten muss, kommen hier einige Kosten auf die Gründer zu. Wie hoch diese Kosten genau sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise wie groß die Genossenschaft ist und wie vollständig die benötigten Unterlagen sind. Die größten Kosten fallen hierbei bei der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung durch die Sachverständigen dar. Insgesamt sollte man bei den Gesamtkosten von einer Summe zwischen 850 und 2.500 Euro rechnen. In Ausnahmefällen, beispielsweise wenn der Prüfungsaufwand sehr hoch ist, können auch Kosten von bis zu 4.000 Euro auf die Gründer zukommen. Ein Mindestkapital ist hierbei nicht vorgeschrieben. Allerdings prüft der Genossenschaftsverband, ob das Eigenkapital für die eG-Gesellschaft ausreicht.
Steuern der eG-Gesellschaft
Eine eingetragene Genossenschaft muss grundsätzlich die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer zahlen. Beide sind von der Höhe des Gewinns abhängig. Außerdem muss zusätzlich die Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt werden. Falls die Genossenschaft Personal beschäftigt, muss die zudem noch Lohnsteuer abführen. Erzielt die Genossenschaft einen Gewinn, gilt es diesen steuerfrei an die Mitglieder zu vergüten.
Für wen eignet sich diese Rechtsform?
Eine eingetragene Genossenschaft ist besonders für mehrere Existenzgründer geeignet, die ein gemeinsamen Ziel verfolgen. Besonders wenn eine spätere, unkomplizierte Erweiterung durch zusätzliche Mitglieder geplant ist, kann sich das Gründen einer eG als Rechtsform sehr lohnen. Vergiss hierbei aber nicht, dass die Genossenschaft auf Unternehmen beschränkt ist, die das Prinzip der Selbsthilfe verfolgen. Somit ist die eG-Gesellschaft nicht für jeden Geschäftszweck uneingeschränkt geeignet.
Fazit: Die Vor- und Nachteile einer eG
Die Entscheidung, welche Rechtsform man beim Gründen des eigenen Unternehmens wählt, sollte gut durchdacht sein. Helfen kann es hierbei, sich die Vor- und Nachteile vor Augen zu halten. So kann man am besten abwägen, ob das Gründen einer eG sinnvoll für einen selbst ist.
Die Vorteile einer eG-Gesellschaft
Die eG bietet viele Vorteile, die besonders für die Gründung im Team sehr hilfreich sein können. Zu diesen gehören unter anderem folgende:
- Kein Mindestkapital notwendig
- Teile des privaten Konsums für Mitglieder steuerfrei
- Demokratische Strukturen
- Hohe Insolvenzsicherheit durch aktive Kontrolle des Prüfverbandes
- Ausschuss des Stimmrechtes bei investierenden Mitgliedern möglich
- Austretende Mitglieder erhalten nur den Nennwert ihrer Anteile zurück, nicht den tatsächlichen Wert
Die Nachteile einer eG-Gesellschaft
Ebenso wie Vorteile gibt es natürlich auch einige Nachteile, die man beim Gründen einer eingetragenen Genossenschaft nicht vergessen darf:
- Weniger Entscheidungsfreiheit einzelner Mitglieder durch das Stimmrecht aller
- Kosten durch Mitgliedschaftspflicht im genossenschaftlichem Prüfverband
- Keine hohen Gewinne der eG-Gesellschaft für Einzelne möglich
- Keine individuelle Förderung für einzelne Mitglieder
- Bei Austritt erhält man nur den Nennwert der Anteile zurück, nicht den tatsächlichen Wert
Die Gründung einer eingetragenen Genossenschaft bietet sich vor allem für Unternehmer oder Kleinunternehmer an, die gemeinsam mit anderen Unternehmen wirtschaftlich vorteilhaft handeln wollen. Hier ist es wichtig, dass alle Mitglieder dasselbe Ziel verfolgen und bei der eG-Gesellschaft darauf hinarbeiten. Für Gründer, die noch gar kein Unternehmen gegründet haben, ist diese Rechtsform daher meistens eher uninteressant. Wenn es aber darum geht, mit dem bestehenden Unternehmen erfolgreicher zu werden und bessere Chancen in den Wirtschaftsmärkten zu haben, kann das Gründen einer eG und die Kooperation mit anderen Unternehmen die optimale Lösung sein.
Wie löst man eine eingetragene Genossenschaft wieder auf?
Genossenschaften enden in der Regel durch den Ablauf der Zeit oder durch den Beschluss der Generalversammlung. Für einen Auslösungsbeschluss ist die Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen notwendig. Die Auflösung der Genossenschaft erfolgt, wie bei einer GmbH auch, durch Liquidation. Diese wird meistens durch den Vorstand durchgeführt. Nach Beendigung der Liquidation wird die Genossenschaft aus dem Register gelöscht und das verbliebene Vermögen, nach einem Jahr Sperrfrist, zu gleichen Teilen unter den Mitgliedern verteilt. Der Vorstand meldet dann die Auflösung der eG beim Register an.
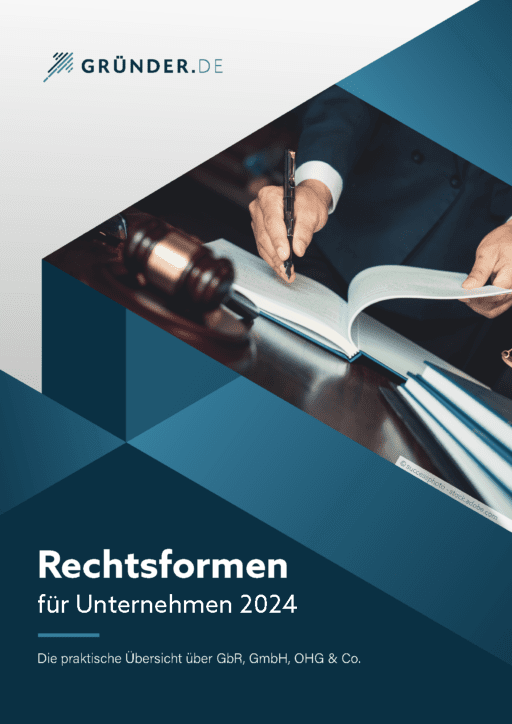
eBook
Entscheidungshilfe für Gründer!
Mit unserem eBook findest du im Handumdrehen die richtige Rechtsform für dein Business
Häufige Fragen (FAQ) zur eingetragenen Genossenschaft
Bei der eingetragenen Genossenschaft handelt es sich um eine Form der Kapitalgesellschaften. Zudem handelt es sich aber auch um ein Kooperationsmodell für mittelständische Unternehmen. Die eG fungiert als juristische Person und verfolgt das Ziel, durch einen Zusammenschluss von Genossen Wissen zu teilen, leichter Aufträge und bessere Chancen auf dem Wirtschaftsmarkt zu bekommen.
1. Firma, Sitz und Gegenstand der eingetragenen Genossenschaft müssen angegeben werden
2. Es muss bestimmt werden, ob die Mitglieder der eG für den Fall, dass Insolvenzzahlungen nicht gedeckt werden können, Nachschüsse zum Geldbetrag unbeschränkt, beschränkt auf seine Summe oder gar nicht leisten müssen
3. In welcher Form sollen Generalversammlungen der Mitglieder einberufen werden?
4. Wie werden Beschlüsse beurkundet?
5. Wer übernimmt den Vorsitz der Versammlung?
6. In welcher Form sollen Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgen und in welchen öffentlichen Blättern sollen diese zu sehen sein?
Eine eG muss in jedem Fall die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer zahlen. Die Höhe der Steuern ist vom Gewinn abhängig. Zudem muss die Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt werden. Sollte noch Personal beschäftigt werden, muss auch die Lohnsteuer gezahlt werden.

Rechtsformen für Unternehmen: GbR, GmbH, OHG & Co.
Wer ein Unternehmen gründen will, dem fehlt oft die Übersicht, welche Rechtsformen es gibt. Wir erklären dir , was die Formen genau bedeuten!

GmbH gründen: Definition und Bedeutung
Wenn du eine GmbH gründen willst, musst du einige Voraussetzungen erfüllen. Wir erklären dir, worauf es bei dieser Rechtsform ankommt.

GmbH & Co. KG gründen: Für wen ist die Mischform geeignet?
Wenn du eine GmbH & Co. KG gründen möchtest, solltest du alles Wichtige über die Rechtsform und die Gründungsphase wissen.
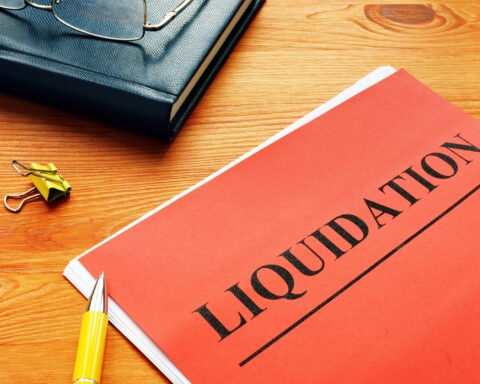
Liquidation GmbH: So löst du dein Unternehmen auf
Du möchtest oder musst dein Unternehmen auflösen? Wir erklären dir in diesem Artikel, was du bei der Liquidation deiner GmbH beachten musst.

Unternehmergesellschaft gründen: Die eigene Firma für 1 Euro?
Eine Firma für nur 1 Euro gründen? Mit der UG haftungsbeschränkt geht das! Alles zur Unternehmergesellschaft & eine kostenlose Checkliste.

Limited gründen: Vorteile und Nachteile im Check
Alle Details, um eine Limited zu gründen. Wir erklären die englische Rechtsform Ltd.: Kosten, Vorteile, Nachteile & alles zum Brexit.
DU willst deine KI-Skills aufs nächste Level heben?
WIR machen dich bereit für die Revolution
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ!
- Praxisbeispiele – sofort anwendbar für dein Business
- Aktuelle KI-Tools im Check
- Expertentipps für die neusten KI-Technologien
- Case Studies – von E-Mail-Marketing bis Datenanalyse
Ja, ich möchte den Newsletter. Die Einwilligung kann jederzeit im Newsletter widerrufen werden. Datenschutzerklärung.
Über den Autor

Luisa Färber
Luisa macht seit Februar 2022 ihr Volontariat in der Online-Redaktion von Gründer.de. Hier ist sie immer auf der Suche nach den neusten Startups mit bahnbrechenden Ideen und spannenden Businessmodellen. Ob Nachhaltigkeit, Food oder FinTech – Luisa recherchiert und schreibt über die Unternehmen von morgen! Außerdem ist sie mitverantwortlich für unsere Kooperationen und bringt Gründer.de auch als Marke voran. Ursprünglich kommt sie aus einem kleinen Dorf in Oberfranken und entschied sich nach dem Abitur für ein Studium der Angewandten Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität Ilmenau in Thüringen. Nach ihrem Bachelor, in dem sie ihre Leidenschaft für die redaktionelle Arbeit entdeckte, hat es sie nun nach Köln und in die Redaktion von Gründer.de verschlagen.



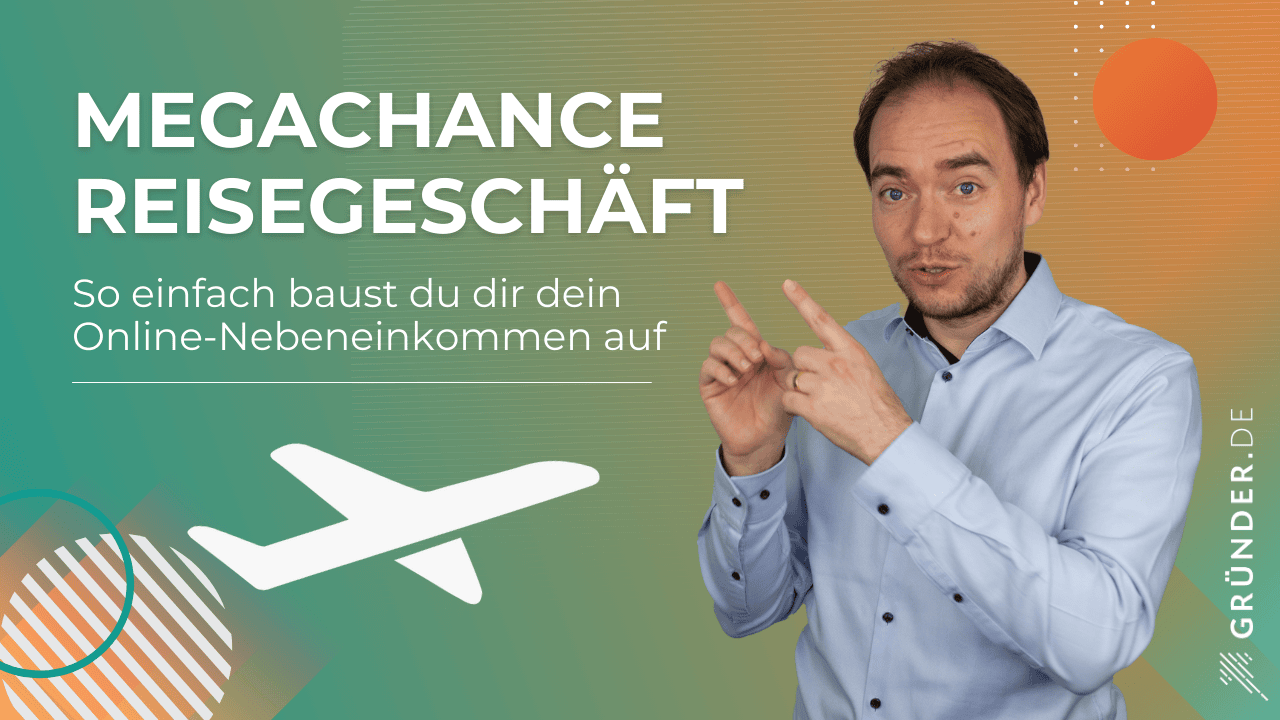
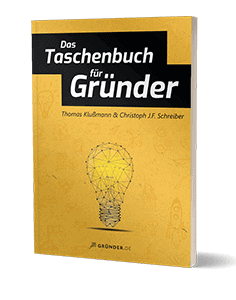
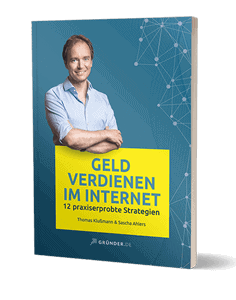
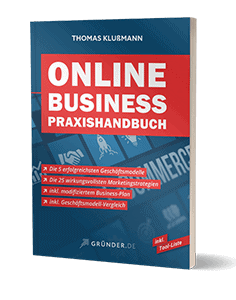
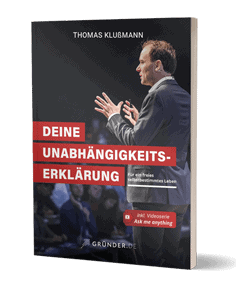
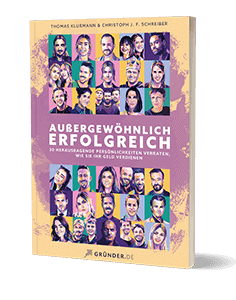
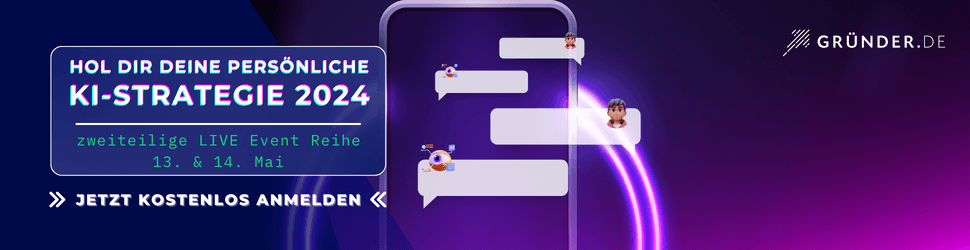

Kommentare sind geschlossen.