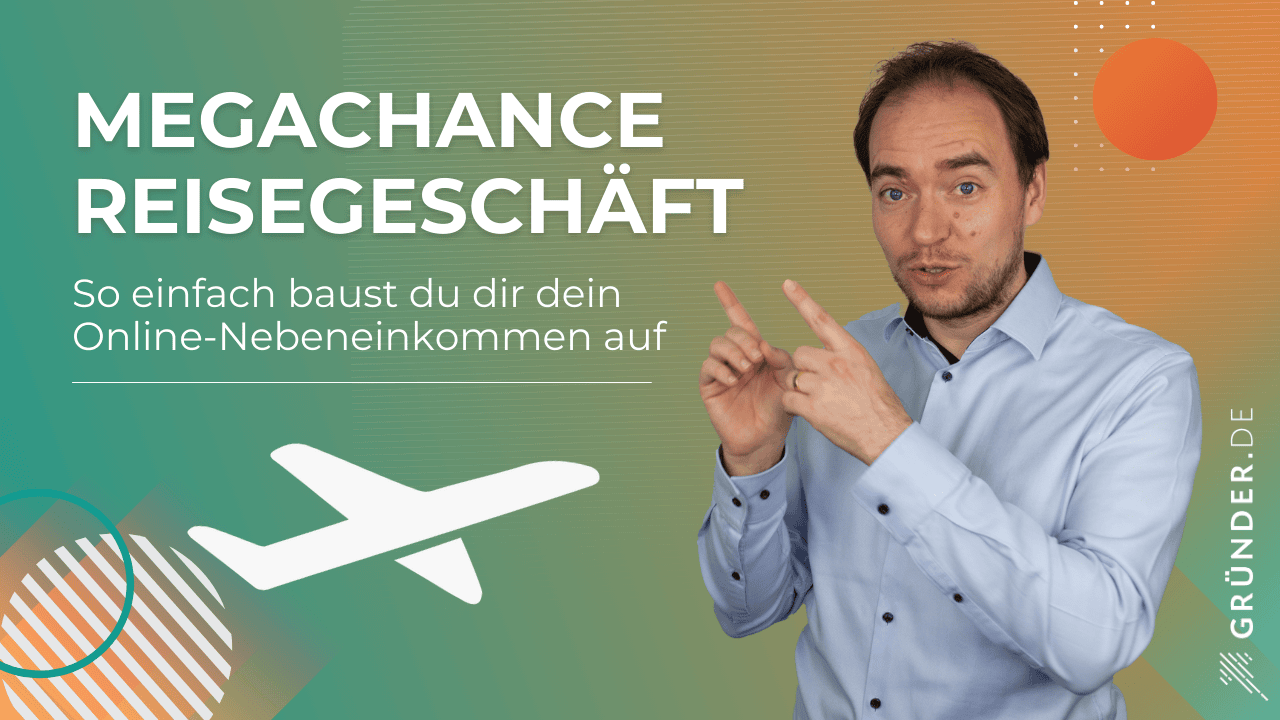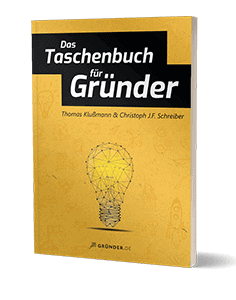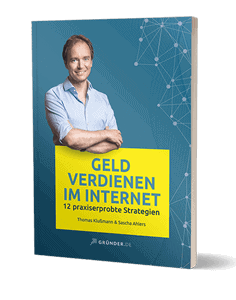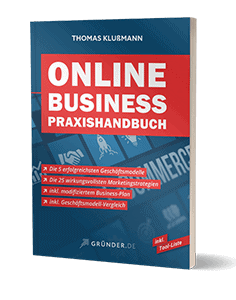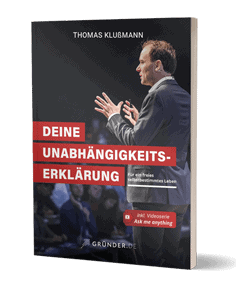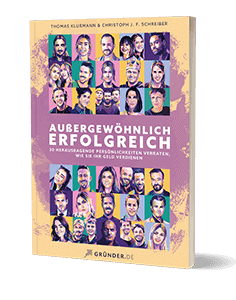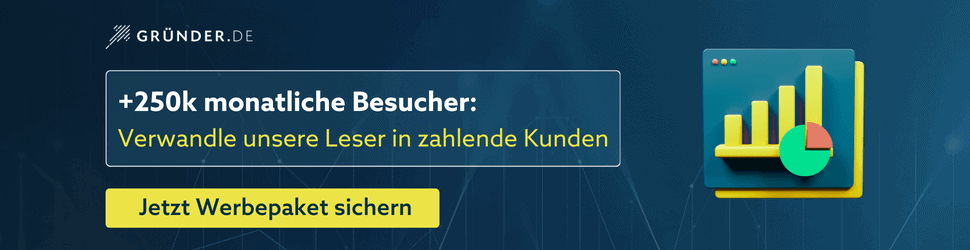Details zur Definition & eine praktische Scheinselbstständigkeit Checkliste
Scheinselbstständigkeit vermeiden: Kriterien erkennen und hohe Strafen verhindern
 Andreas Fricke, Insa Schoppe und Luisa Kleinen
| 29.02.2024
Andreas Fricke, Insa Schoppe und Luisa Kleinen
| 29.02.2024

Featured image: kai - stock.adobe.com
Wer eine Scheinselbstständigkeit betreibt, muss mit zahlreichen Konsequenzen rechnen.
Inhaltsverzeichnis
- Definition: Scheinselbstständigkeit
- In diesen Branchen und Berufe ist Scheinselbstständigkeit ein Thema
- Kriterien einer Scheinselbstständigkeit
- Strafen einer Scheinselbstständigkeit
-
Checkliste, um Scheinselbstständigkeit zu vermeiden – Die Kriterien
- Checkliste Punkt 1: Den Vertrag ganz genau prüfen
- Checkliste Punkt 2: Keine Anweisungen zur Ausübung der Tätigkeit akzeptieren
- Checkliste Punkt 3: Keine zusätzlichen Vorgaben zum Zeitmanagement hinnehmen
- Checkliste Punkt 4: Eigenes Design verwenden
- Checkliste Punkt 5: Marketingmaßnahmen anwenden
- Checkliste Punkt 6: Eigene Technik verwenden
- Checkliste Punkt 7: Klare Absprachen durch persönliche Gespräche
- Schutz gegen den Vorwurf einer Scheinselbstständigkeit
- Fazit: Die Kriterien von Scheinselbstständigkeit frühzeitig überprüfen!
- Häufige Fragen (FAQ) zu Scheinselbstständigkeit
Gesamtes Inhaltsverzeichnis anzeigen
Definition: Scheinselbstständigkeit
Eine Scheinselbstständigkeit (oder auch Scheinselbständigkeit, beide Schreibweisen sind korrekt) liegt vor, wenn Erwerbstätige, die gemäß ihres Vertragsverhältnisses eigentlich selbstständig sind, sich de facto in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis befinden. Besonders schnell im Verdacht sind hier Freelancer, die regelmäßig Auftragsarbeiten ausführen. Nehmen wir an, ein selbstständiger Freelancer führt sehr regelmäßig Aufträge für ein dasselbe Unternehmen aus. Nach außen sieht es dann so aus, als könne er sich auf den Erhalt der Aufträge verlassen – wie in einem normalen Angestelltenverhältnis. Nur zahlen weder er noch das Unternehmen entsprechend Lohnsteuer oder Sozialabgaben. Das ist verboten und wird mit hohen Geldstrafen geahndet.
In diesen Branchen und Berufe ist Scheinselbstständigkeit ein Thema
Prinzipiell das größte Risiko für eine scheinselbstständige Tätigkeit haben Freelancer oder freie Mitarbeiter, die einem auftraggebenden Unternehmen ihre Dienste zur Verfügung stellen. Dazu gehören:
- Freiberufler ohne Angestellte
- Gewerbetreibende Einzelunternehmer ohne Angestellte
- Einzelkaufleute ohne Angestellte
- Gesellschafter einer GbR ohne Angestellte
Zu den Branchen und Berufsbildern, in denen Scheinselbstständigkeit häufig ein Thema ist, gehören unter anderem:
- IT-Berater
- Fahrer im Speditionsgewerbe und Kurierfahrer
- Reinigungskräfte
- Grafikdesigner und Texter
- Programmierer
- Lehrkräfte
- Honorarärzte
- Handwerker
Kriterien einer Scheinselbstständigkeit
Eine Prüfung der Scheinselbstständigkeit wird hauptsächlich von der Deutschen Rentenversicherung, einem Arbeitsgericht, dem Finanzamt oder Sozialversicherungen durchgeführt. Auch ein Auftragnehmer oder ein Auftraggeber können dies prüfen, beispielsweise wenn ein Auftragnehmer Kündigungsschutz einklagt oder ein Auftraggeber das Vertragsverhältnis beenden möchte. Insgesamt müssen bei jeder Prüfung jedoch bestimmte Kriterien der Scheinselbstständigkeit-Checkliste erfüllt sein, um jemanden dieses Vergehens beschuldigen zu können.
Scheinselbstständigkeit prüfen – die Checkliste für Kriterien
Wenn eine deutsche Behörde eine mögliche Scheinselbstständigkeit prüfen möchte, werden dafür bestimmte Kriterien herangezogen, die eine Entscheidung erleichtern sollen. Die folgenden Kriterien sind im Rahmen der Checkliste für eine Prüfung wichtig:
- Der Überprüfte arbeitet alleine und beschäftigt keine Mitarbeiter.
- Der Überprüfte ist regelmäßig oder über lange Zeit für nur einen Auftraggeber tätig.
- Es werden 85 Prozent der gesamten Umsätze durch einen einzigen Auftraggeber eingenommen.
- Der Überprüfte war vorher als Arbeitnehmer angestellt und hat in diesem Zeitraum dieselbe Tätigkeit ausgeführt oder im selben Arbeitsbereich gearbeitet.
- Die Arbeit findet hauptsächlich an einem Arbeitsplatz im Unternehmen statt.
- Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit ist eingeschränkt oder nicht vorhanden, weil Preise zum Beispiel immer vom Auftraggeber vorgegeben werden.
- Alle Aufträge des Auftraggebers müssen übernommen und können nicht abgegeben werden.
- Der Auftraggeber gibt die Arbeitszeiten, Urlaubszeiten und Details zur Ausführung der Tätigkeit vor.
- Der Überprüfte ist bei der Arbeitsorganisation des Unternehmens dabei, zum Beispiel durch die Teilnahme an Meetings.
- Der Überprüfte setzt keine eigene Marketing-Maßnahmen um.
Wenn eines dieser Kriterien erfüllt ist, weist das allerdings nicht automatisch auf eine positive Prüfung der Scheinselbstständigkeit hin. Denn letztendlich entscheidet eine individuelle Prüfung, die alle Abläufe und aktuellen Umstände berücksichtigt.
Strafen einer Scheinselbstständigkeit
Wer einer Scheinselbstständigkeit beim Prüfen überführt wird, muss mit rechtlichen und finanziellen Konsequenzen rechnen. Die folgenden Strafen ergeben sich dabei für Auftraggeber und Auftragnehmer:
Strafen für Auftraggeber
Ein Auftraggeber muss bei einer Scheinselbstständigkeit rückwirkend allen sogenannten Haftungs- und Zahlungsverpflichtungen nachkommen, die für reguläre Angestellte anfallen. Das heißt, dass der Auftraggeber die Beiträge zur Sozialversicherung für bis zu vier Jahre rückwirkend als Teil der Strafen nachzahlen muss. Auch die Ausweisung der Umsatzsteuer auf den Rechnungen des Scheinselbstständigen wird unwirksam. Somit gilt der Vorsteuerabzug als unzulässig und die abgezogenen Vorsteuerbeträge müssen zurückgezahlt werden.
Außerdem kann das Finanzamt in einem solchen Fall die Lohnsteuernachzahlungen rückwirkend einfordern, ebenfalls für bis zu vier Jahre. Wird dann eine vorsätzliche Handlung nachgewiesen, sind auch Bußgelder, Gefängnisstrafen und Rückzahlungsforderungen für bis zu 30 Jahre als Strafen möglich. Allerdings muss für alle Strafen ein klares Ergebnis vorliegen, also die Scheinselbstständigkeit muss ganz klar bewiesen sein.
Strafen für Auftragnehmer
Als erste Auswirkung , bekommt der Auftragnehmer als Strafe den Status des Arbeitnehmers. Dieser gilt nachträglich zum Beginn des Beschäftigungsverhältnisses. Bei einem freien Mitarbeiter muss damit auch das Gewerbe beim Gewerbeamt abgemeldet werden und die Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer endet zu diesem Zeitpunkt. Da der Auftraggeber und Auftragnehmer als sogenannte Gesamtschuldner gelten, kann der Auftraggeber als Teil der Strafen die Nachzahlungen der Sozialversicherungsbeiträge vom zukünftigen Gehalt abziehen. Auch bisher ausgestellte Rechnungen sind bei einer festgestellten Scheinselbstständigkeit zu berichtigen. Somit gilt die angegebene Umsatzsteuer als ungültig und die Vorsteuer muss laut Checkliste an das Finanzamt zurückgezahlt werden.
Checkliste, um Scheinselbstständigkeit zu vermeiden – Die Kriterien
Wer sich eine lästige Prüfung oder rechtliche bzw. finanzielle Konsequenzen ersparen möchte, sollte bestimmte Maßnahmen ergreifen und damit vorbeugend handeln. Die folgende Checkliste hilft, um die Scheinselbstständigkeit zu vermeiden:
Checkliste Punkt 1: Den Vertrag ganz genau prüfen
Die ersten Anzeichen lassen sich schon im Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer erkennen. Deshalb lohnt es sich, diesen Vertrag genau zu prüfen. Tauchen dort zum Beispiel nur Tätigkeiten auf, die ebenfalls von einem regulären Angestellten durchgeführt werden, weist dieser Vertrag auf eine Scheinselbstständigkeit hin.
Checkliste Punkt 2: Keine Anweisungen zur Ausübung der Tätigkeit akzeptieren
Wer selbstständig ist, muss gewisse Anweisungen nicht akzeptieren. Zum Beispiel entscheidet ein Freelancer selbst, wo er seine Arbeit ausübt und muss zum Beispiel auch nicht an einem Firmen-Meeting mit allen anderen Mitarbeitern teilnehmen. Sobald der Auftraggeber eine solche Anweisung ausspricht, sollte er an die bestehenden Vertragsdetails erinnert werden, um eine Scheinselbstständigkeit zu vermeiden.
Checkliste Punkt 3: Keine zusätzlichen Vorgaben zum Zeitmanagement hinnehmen
Natürlich ist oftmals vertraglich festgehalten, bis wann ein bestimmter Auftrag erledigt sein muss. Aber die genauen Arbeits- und Abwesenheitszeiten entscheidet der Selbstständige selbst. Auch die Urlaubszeiten sind dabei inbegriffen, denn diese kann jeder Freelancer oder freie Mitarbeiter selbst bestimmen. Kommen also wiederholt Vorgaben zum Zeitmanagement, steigt das Risiko für eine mögliche Scheinselbstständigkeit.
Checkliste Punkt 4: Eigenes Design verwenden
Jeder Selbstständige sollte ein eigenes Firmenlogo verwenden, um die Wahrscheinlichkeit für eine Scheinselbstständigkeit zu minimieren und als Unternehmer wahrgenommen zu werden. Deshalb wäre das Firmenlogo des Auftraggebers auf den eigenen Visitenkarten zum Beispiel fehl am Platz. Gleichzeitig sollte der eigene Name nicht auf der Website des Auftraggebers auftauchen, auch nicht als externer Berater, denn das spricht ebenfalls für eine dauerhafte Zusammenarbeit.
Checkliste Punkt 5: Marketingmaßnahmen anwenden
Wer selbstständig ist, muss im Normalfall auch Marketingmaßnahmen einleiten, um neue Kunden zu bekommen. Wenn diese Ausgaben komplett fehlen, kann das auf eine Scheinselbstständigkeit hinweisen. Allerdings lässt sich diese Vorgehensweise auch begründen, wenn zum Beispiel finanzielle Probleme und damit kein Budget für Marketing vorhanden sind.
Checkliste Punkt 6: Eigene Technik verwenden
Wenn sich die Arbeit eines Freelancers oder freien Mitarbeiters nur mit dem technischen Equipment des Auftraggebers erledigen lässt, weist diese Tatsache auf eine vorhandene Abhängigkeit hin. Noch extremer wäre es, wenn dieses Equipment sogar eine Kontrollfunktion beinhaltet. Deshalb ist es wichtig, möglichst eigenständig zu arbeiten, eigene Technik zu besitzen und damit dieses Kriterium für eine Scheinselbstständigkeit zu vermeiden.

eBook
22 geniale Möglichkeiten um 2024 einfach online Geld zu verdienen
Schnapp dir jetzt unser kostenloses eBook und starte mit deinem eigenen Online Business durch!
Checkliste Punkt 7: Klare Absprachen durch persönliche Gespräche
Egal ob Auftraggeber oder Auftragnehmer, beide Seiten tragen die Verantwortung für eine Scheinselbstständigkeit. Deshalb macht es Sinn, bei aufkommenden Problemen oder Missverständnissen sofort das Gespräch zu suchen. Denn so lassen sich im besten Fall nicht Prüfungen vermeiden, sondern auch Folgeprobleme umgehen.
Schutz gegen den Vorwurf einer Scheinselbstständigkeit
Wer sich vorsorglich absichern gegen den Vorwurf einer Scheinselbstständigkeit absichern möchte, kann ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen. In einem kostenlosen Formular müssen der Auftraggeber und Auftragnehmer zunächst Angaben zum Beschäftigungsverhältnis machen. Anschließend wird der Status dann von der Deutschen Rentenversicherung geprüft. Somit lassen sich dann Zweifel bei der Einordnung beseitigen und der festgelegte Status kann sich als Checkliste auch positiv für die Suche nach weiteren Auftraggebern auswirken.
Fazit: Die Kriterien von Scheinselbstständigkeit frühzeitig überprüfen!
Insgesamt ist es schwierig, eine klare Grenze zwischen Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit zu definieren. Denn oftmals sind zwar Kriterien für eine Selbstständigkeit erfüllt, jedoch lassen sich diese auch begründen und führen deshalb noch nicht zu rechtlichen oder finanziellen Konsequenzen bzw. Strafen. Wer sich komplett absichern möchte, sollte daher das Statusfeststellungsverfahren beantragen oder sich von einem Anwalt für Arbeitsrecht beraten.
Häufige Fragen (FAQ) zu Scheinselbstständigkeit
Der Begriff Scheinselbstständigkeit beschreibt Erwerbstätige, die gemäß ihres Vertragsverhältnisses selbstständig tätig sind, sich aber tatsächlich in einem sozialversicherungspflichtigen, abhängigen Beschäftigungsverhältnis befinden. Weil damit die Zahlung von Lohnsteuer und Sozialbeiträgen vermieden wird, drohen hohe finanzielle Strafen.
Die Scheinselbstständigkeit erkennt man, wenn der Überprüfte zum Beispiel alleine arbeitet und keine Mitarbeiter beschäftigt. Wenn er regelmäßig oder über lange Zeit für nur einen Auftraggeber tätig ist. Oder 85 Prozent der gesamten Umsätze durch einen einzigen Auftraggeber eingenommen werden.
Wer eine Scheinselbstständigkeit betreibt, wird dafür bestraft. Ein Auftraggeber muss dann allen sogenannten Haftungs- und Zahlungsverpflichtungen nachkommen, die für reguläre Angestellte anfallen. Dagegen müssen Auftragnehmer alle steuerlich gesparten Summen zurückzahlen.

Geld verdienen als Freelancer: 5 spannende Branchen, die du kennen musst
Beim Geld verdienen als Freelancer gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Doch diese 5 spannenden Branchen werden oft unterschätzt.

Mit 7 Schritten in die Selbstständigkeit
Erste Schritte in die Selbstständigkeit ✓ Unternehmensgründung ✓ 7 Schritte wie du dein Unternehmen gründest ✓ Bürokratische Hürden meistern

Die 10 größten Mythen der Selbstständigkeit: Nur typische Klischees?
Wenig arbeiten und viel verdienen? Oder doch nur 24/7 am Schuften? Über Selbstständige gibt es viele Mythen, wir haben die 10 Größten gesammelt.

Motivation als Selbstständiger: Was dich neben dem Geld antreiben sollte
Was motiviert dich als Selbstständiger neben dem Geld? Wir haben die wichtigsten Punkte zum eigenen Antrieb herausgefunden. ➔ Jetzt mehr erfahren!

Selbstständig im Nebenberuf: Diese Hürden warten auf dich
Welche Herausforderungen warten auf dich, wenn du dich im Nebenberuf selbstständig machst? Wir zeigen die Hürden und helfen bei deinem Weg.
DU willst deine KI-Skills aufs nächste Level heben?
WIR machen dich bereit für die Revolution
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ!
- Praxisbeispiele – sofort anwendbar für dein Business
- Aktuelle KI-Tools im Check
- Expertentipps für die neusten KI-Technologien
- Case Studies – von E-Mail-Marketing bis Datenanalyse
Ja, ich möchte den Newsletter. Die Einwilligung kann jederzeit im Newsletter widerrufen werden. Datenschutzerklärung.
Über den Autor

Andreas Fricke
Andreas war von März 2022 bis Februar 2024 in der Redaktion von Gründer.de. Hier verantwortete er die Bereiche Franchise- und Gründer-Verzeichnis, außerdem arbeitet er regelmäßig an neuen Büchern und eBooks auf unserem Portal. Zuvor hat er 5 Jahre lang in einer Online-Marketing-Agentur für verschiedenste Branchen Texte geschrieben. Sein textliches Know-how zieht er aus seinem Studium im Bereich Journalismus & Unternehmenskommunikation.